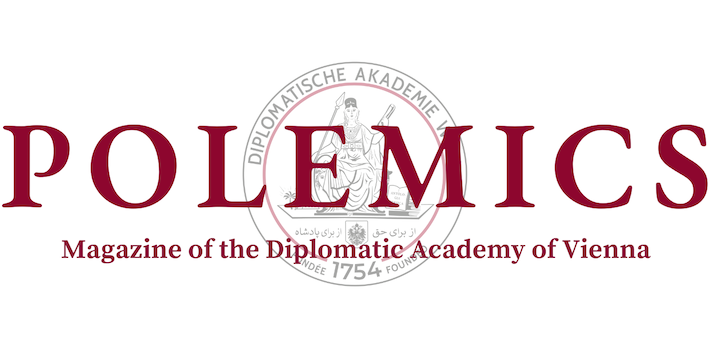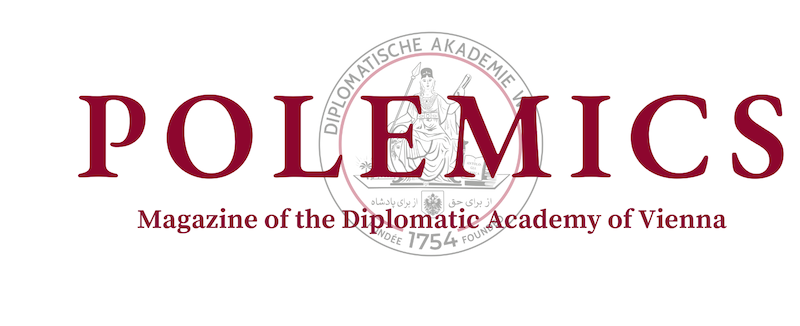Das österreichische Lagerdenken nimmt ab; mitunter auch, weil die Sozialdemokratie nicht mehr mithalten kann.
Wenn im November in den USA über das Präsidentenamt abgestimmt wird, werden nicht nur die AmerikanerInnen, sondern auch unzählige andere Menschen aus aller Welt gebannt auf ihren Bildschirmen beobachten, wie ein Bundesstaat nach dem anderen entweder rot oder blau eingefärbt wird.
Umgekehrt beschäftigen sich jedoch vergleichsweise wenige US-BürgerInnen mit europäischer Politik, was aufgrund der geringeren Bedeutung auch nicht weiter überrascht. Hinzu kommt, dass aus amerikanischer Sicht die Politiklandschaft vieler Länder des alten Kontinents wenig verständlich ist: Während die USA gänzlich von zwei Parteien dominiert werden (mit sehr wenigen Ausnahmen), kann man in europäischen Parlamenten angesichts der Parteienvielfalt schnell einmal den Überblick verlieren. Allein im österreichischen Nationalrat ringen derzeit fünf Parteien um Einfluss, drei weitere haben im vergangenen Jahrzehnt zudem noch mitgemischt.
Es könnte also verziehen werden, politische Systeme wie das österreichische dem amerikanischen diametral entgegengesetzt zu verorten. Dieser Schluss greift jedoch zu kurz; vor allem in den ersten Dekaden der Zweiten Republik wurde die Politik des Landes von zwei übermächtigen Parteien bestimmt – der ‚roten‘ Sozialdemokratie (SPÖ) und der konservativen ‚schwarzen‘ Volkspartei (ÖVP). Auch heute noch ist nicht nur das politische, sondern auch das Gesellschafts- und Wirtschaftsleben Österreichs stark von diesem Dualismus geprägt.
In groben Zügen lässt sich diese rot-schwarze Bipolarität durchaus mit der amerikanischen red– vs. blue-Dynamik vergleichen. In vielen Aspekten reicht diese österreichische Dichotomie jedoch wesentlich tiefer als die amerikanische: Die enge Verflochtenheit zwischen den politischen Parteien und dem gesellschaftlichen Leben führte in Österreich dazu, dass vielen gesellschaftlichen Vereinen ein politischer Gedanke zu Grunde lag. Der österreichische Fußball-Rekordmeister Austria Wien beispielsweise wurde als bürgerliche Antithese zum ‚roten‘ Rapid Wien gegründet. An fataler politischer Relevanz gewann dieser Dualismus bereits mit Einzug der Demokratie nach Ende des ersten Weltkrieges: Unterstützt von bewaffneten Milizen mündete diese Rivalität 1934 in einem kurzen Bürgerkrieg sowie in einer von den Konservativen gestützten Diktatur.
Nach der Wiedergeburt des demokratischen Österreichs 1945 wurde dieses militante Gegenüber in die Geschichtsbücher verbannt; dennoch versuchten die Parteien ihren Einfluss über Staat und Gesellschaft vis-à-vis dem anderen Lager zu vergrößern, beispielsweise durch gezielte Postenbesetzungen in Ministerien, verstaatlichten Betrieben oder diversen Vereinen.
Darüber hinaus rekrutieren sich, heute wie damals, viele politische Kader aus solchen Vorfeldorganisationen. Eine überwältigende Mehrheit aller ‚schwarzen‘ Minister seit 1945 waren beispielsweise Mitglied einer der Partei nahestehenden Studentenorganisation en. Umgekehrt war und ist ein Engagement in der Sozialistischen Jugend oder dem Verband Sozialistischer StudentInnen aufstrebenden JungpolitikerInnen des linken Spektrums äußerst dienlich.
Aufs Erste mag dieses politische System veraltet wirken. Aber auch hier muss relativiert werden: Seit Ende des zweiten Weltkrieges ging diese ‚Zweiteilung‘ vieler Aspekte des österreichischen Lebens einher mit einer, über lange Sicht gesehenen, gleichberechtigten Aufteilung von Einfluss und Verantwortung. Während die Sozialdemokratie ihre Stärke aus der Arbeiterschaft schöpfte, galt die Volkspartei als Partei der (Land-)Wirtschaft. Anders als in der Zwischenkriegszeit führte das Verhältnis dieser beiden Pole aber nicht zu unüberbrückbaren Konflikten, sondern zu einem guten Verhältnis zwischen Arbeiterschaft und Unternehmertum. Die daraus resultierende und auf Konsens basierende Sozialpartnerschaft wird weitgehend als Basis für die politische und soziale Stabilität Österreichs gesehen.
In jüngerer Vergangenheit scheinen sich diese Strukturen aber radikal zu verändern. Nicht nur verlieren die ‚rot‘ oder ‚schwarz‘ gefärbten Organisationen zunehmend ihre parteipolitische Prägung, auch das politische System selbst befindet sich im Umbruch. Das Erstarken anderer Parteien wie der rechten FPÖ sowie die Gründung neuer Bewegungen wie der Grünen relativierte den Einfluss von ‚Rot‘ und ‚Schwarz‘ etwas, wenn auch zunächst in ausgeglichenem Maße. In den vergangenen zwei Nationalratswahlen vergrößerte sich der Abstand zwischen den beiden Parteien jedoch immer mehr. Während die ÖVP stetig an Stimmen und Einfluss gewinnen konnte, befindet sich die SPÖ spätestens seit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis 2019 in einer Krise.
Mit radikalen Forderungen zu Arbeits- und Frauenrechten sowie einem leistbareren Gesundheits- und Bildungssystem vertrat die Sozialdemokratie vor allem in ihrer Blütezeit in den 1970er Jahren eine überaus fortschrittliche Politik und konnte überwältigend viele ihrer Forderungen durchsetzen und das Leben aller ÖsterreicherInnen nachhaltig verbessern. Dadurch hat sie auch eine treue Wählerschaft, bestehend vor allem aus der Arbeiterklasse, an sich gebunden. Zusätzlich zu momentanen Problemen wie einer führungsschwachen Parteispitze, führen nun aber auch strukturelle Probleme dazu, dass sich immer mehr dieser WählerInnen von ‚ihrer‘ Partei abwenden.
Die breitflächige Einführung und Akzeptanz der von der SPÖ gesetzten sozialen Standards führte dazu, dass jede ihrer zusätzlichen Forderungen an ‚revolutionärer‘ Bedeutung und somit an Echo verlor. Durch den eigenen Erfolg kannibalisierte sich die SPÖ selbst: ihrePolitik gab vielen Menschen in Österreich ein besseres Leben, sodass diese sich nun weniger um Fragen der sozialen Sicherheit sorgen müssen und sich zunehmend anderen politischen Fragen widmen können. Die gesellschaftspolitisch ‚linke‘ Orientierung der SPÖ scheint dabei in vielen Fragen nicht mehr im Einklang mit der Weltanschauung ihrer traditionellen Wählergruppe. Beispielsweise weckte die Flüchtlingskrise von 2015 bei vielen vor allem sozial schwächer gestellten Menschen die Furcht vor dem eigenen Bedeutungsverlust. Antworten auf diese Fragen wurden vielfach aber nicht bei der SPÖ, sondern bei der rechts-populistischen FPÖ gefunden. Die ÖVP erkannte diesen Zeitgeist und rückte in genau solchen Fragen nach rechts und sammelte infolgedessen viele vormals rote, dann zunächst blau-gewordenen Wähler auf.
Dies ist aber ein nicht nur rein österreichisches Phänomen. Die Sozialdemokratie als länderübergreifende Parteifamilie befindet sich auch in den meisten anderen Ländern in einer Krise. Noch zur Jahrtausendwende stellten Sozialdemokraten die Regierungen von zwei der größten europäischen Länder, Deutschland und Großbritannien. Nach einer schrittweisen Liberalisierung in Wirtschaftsfragen verlor ein Teil der sozialdemokratischen Kernklientel in diesen Ländern jedoch das Vertrauen. Heute sind sozialdemokratische Parteien da wie dort weit abgeschlagen hinter ihren konservativen Kontrahenten.
Wo auch immer man den schrittweisen Bedeutungsverlust der Sozialdemokratie verorten mag: er hat jedenfalls in die politische und gesellschaftliche Realität Österreichs Einzug gehalten. Und dieser Bedeutungsverlust kann über kurz oder lang nur dazu führen, dass die SPÖ auch ihren Einfluss über das gesellschaftliche Leben außerhalb der Politik verliert. Zwar sollte man die momentane Stärke der ‚Schwarzen‘ nicht gleichsetzen mit einer Wiedergeburt konservativen Denkens in Österreich, aber in Ermangelung einer Alternative scheint es, als habe sich die ÖVP auf Jahre die Dominanz über das politische System der Republik gesichert.
Edited by Maximilian Gruber
Picture taken by Hu Zixiang