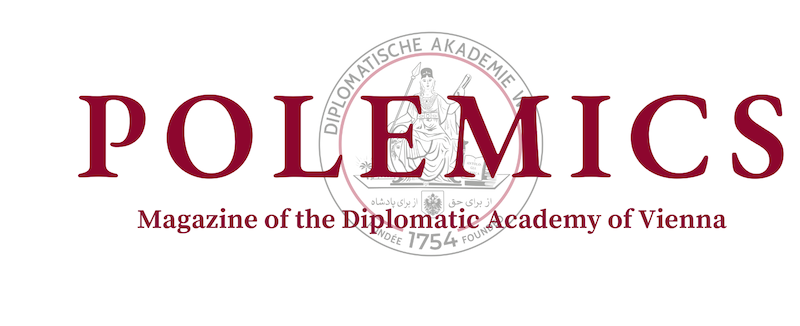Spätestens seit Caroline Criado-Perez’ Werk „Die unsichtbaren Frauen: Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert“ rückt die systematische Benachteiligung von Frauen bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten immer mehr in unser Bewusstsein. Einen großen Teilbereich nimmt dabei die Medizin ein, welche die Gesundheit von Frauen durch ihre Ausrichtung auf die männliche Norm gefährdet – zum Beispiel bei der Verabreichung von überwiegend an Männern getesteten Medikamenten.
Auf dieser Grundlage überrascht es nicht, dass ein sogenannter Gender-Bias auch bei psychischen Krankheiten eine Rolle spielt. Ein Gender-Bias deutet auf einen geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekt hinsichtlich Krankheitsentwicklung und Diagnose hin. Immer häufiger werden in diesem Zusammenhang zwei Krankheiten erwähnt: Autismus-Spektrum-Störungen und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Als psychische Störungen haben sie nichts miteinander gemein. Lange ging die Wissenschaft aber bei beiden davon aus, dass der Anteil der betroffenen Männer weitaus höher ist als jener der Frauen.
Neuere Forschungen zeigen nun, dass dieses ungleiche Verhältnis tatsächlich auf eine diagnostische Verzerrung zugunsten des männlichen Geschlechts zurückzuführen ist. Symptome und Verhaltensweisen, die als Diagnoseparameter herangezogen werden, basieren überwiegend auf Studien mit Jungen und Männern, was die Diagnose von Mädchen und Frauen erschwert. Dies hat oft gravierende Folgen für den Lebensverlauf betroffener Frauen: Sie werden lange nicht entsprechend behandelt, fühlen sich anders als die anderen und scheitern in vielen Lebensbereichen – ohne zu wissen, warum. Für viele kommt die oft als Erleichterung empfundene Diagnose spät und erst nach mehreren Fehldiagnosen und -behandlungen. Bei vielen bleibt die Krankheit ein Leben lang unerkannt.
Vor allem Autismus-Spektrum-Störungen werden bei Jungen bereits im frühkindlichen Alter erkannt. Als „typische“ Merkmale gelten zum Beispiel fokussierte Interessen – etwa an Busfahrplänen -, fehlende Impulskontrolle, beeinträchtigte Kommunikation und mangelnde soziale Interaktionsfähigkeit. Neuere auf Autistinnen konzentrierte Studien lassen vermuten, dass weibliche Betroffene soziale Normen schneller erkennen und bessere Anpassungsmechanismen entwickeln, um ihre Andersartigkeit nach außen hin zu verbergen. Dies gelingt ihnen zum Beispiel dadurch, dass sie das Verhalten anderer Mädchen imitieren oder bestimmte Verhaltensformen auswendig lernen, um nicht aufzufallen.
Ähnlich ist es bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der Begriff „Narzissmus“, wie wir ihn alltagssprachlich für Selbstbewunderung nutzen, ist hier von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung abzugrenzen. Auch hier neigen Frauen zu einer Ausprägung des allgemein anerkannten Krankheitsbildes, die nicht mit den „klassischen“ Narzissmus- Merkmalen in Verbindung gebracht werden kann und dadurch leicht übersehen wird. Und das, obwohl diese Ausprägung mittlerweile in der Psychologie als spezielle Form der Narzissmus-Störung anerkannt ist: der sogenannte verdeckte oder vulnerable Narzissmus. Dennoch beschäftigen sich bis heute wenige Forschungen und nur vereinzelt Psychotherapeuten und -therapeutinnen speziell mit dieser Form. Das Konzept des verdeckten Narzissmus wurde in den 1990er Jahren geprägt. Erst 2013 aber inkludierte zum Beispiel die American Psychiatric Association die verdeckte Form in die Klassifikation der narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
Der Kern der Krankheit ist bei der klassischen – der offenen – und der verdeckten Form derselbe: eine tiefgreifende Selbstunsicherheit, kompensiert durch eine überzogene Selbstwahrnehmung und genährt durch Bestätigung von außen. Die Kompensationsmechanismen sind jedoch unterschiedlich. Während Betroffene der offenen Narzissmus- Störung ihre Schwäche durch Arroganz, Überheblichkeit und Abwertung anderer ausgleichen, versuchen dies Betroffene der verdeckten Form durch Überanpassung, Leistung und diskrete Manipulation. Dabei sind letztere durch ein ausgeprägtes Feingefühl in der Lage, viel Empathie zu zeigen und sich auf die Wünsche und Erwartungen ihres Gegenübers einzustellen.
Da dies grundsätzlich als das genaue Gegenteil der allgemein bekannten Narzissmus-Störung gilt, ist die verdeckte Form schwerer zu erkennen. Die Betroffenen sind – ähnlich wie im Fall der Autistinnen – dazu fähig, sich an soziale Normen anzupassen. In ihrem Fall bedeutet das, Impulse zu Selbstbezogenheit und Großspurigkeit zu unterdrücken, bescheiden, schüchtern und hilfsbereit aufzutreten, um so in indirekter Form ihr Bedürfnis nach Bewunderung von außen einzufordern. Das hängt auch damit zusammen, dass nicht betonte Überheblichkeit und Selbstverliebtheit das empfundene Selbstwertgefühl prägen, sondern zwei Extreme, die sich ständig abwechseln: überhöhte Selbstwahrnehmung auf der einen und übertriebene Selbstunsicherheit und Minderwertigkeitskomplexe auf der anderen Seite.
Die Ursachen für die tendenziell geschlechtsabhängigen Unterschiede bei beiden Störungen sind unklar. Die Faktoren dafür sind unzählig und die Zusammenhänge so komplex, dass sich diese Frage wohl in die breitere Debatte darüber einordnen lässt, ob Geschlechtsunterschiede nun erlernte gesellschaftliche Konstrukte oder doch evolutionäres Erbe sind. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass zumindest bei der Ausprägung des pathologischen Narzissmus eine an Geschlechterrollen orientierte Erziehung eine große Rolle spielt. So prägen Stereotype der männlichen Durchsetzungsfähigkeit auch heute noch die Erziehung und die Erwartung an Mädchen, sich anzupassen, sensibel zu sein und Empathie zu zeigen. Dies spiegelt sich in der subtileren und von größerer Unsicherheit geprägten Erscheinungsform des verdeckten Narzissmus wider. An dieser Stelle soll betont werden, dass die Narzissmus-Typen selbstverständlich nicht als eindeutige Kategorien, sondern als Spektrum zu verstehen sind, und auch Männer, wenn auch tendenziell seltener, zur verdeckten Ausprägung neigen können.
Bei Autismus-Spektrum-Störungen fällt auf, dass die weiblichen autistischen Verhaltensmuster, wie passives Verhalten und Rückzug statt mangelnder Impulskontrolle, dem weiblichen Rollenbild von „schüchtern und bescheiden“ entsprechen und dadurch seltener als pathologische Auffälligkeit gedeutet werden. Sogar das typische Vermeiden von Blickkontakt, das bei Jungen als ein Anzeichen von Autismus gilt, wird bei Mädchen oft als weibliche Schüchternheit abgetan.
Für weibliche Betroffene beider Krankheiten, so unterschiedlich diese in ihrem Ursprung und ihrer Behandlung auch sein mögen, gilt: Unnatürliche Anpassung und Maskierung des eigenen Ich erfordern hohe Anstrengung und resultieren in schmerzhafter Selbstverleugnung und Selbstentfremdung. Eine richtige, frühzeitige Diagnose kann Betroffenen ihre Lebensbedingungen stark erleichtern und Fehlbehandlungen, zum Beispiel mit Psychopharmaka, verhindern. Daher ist es wünschenswert, dass im Kontext des allgemein vorherrschenden Gender-Bias in der Medizin auch bei psychischen Erkrankungen in Zukunft mehr Rücksicht auf geschlechtsspezifische Unterschiede genommen wird.
Written by Sabrina Kaschowitz; Edited by Dorothea Newerkla; Photo Credit to Geralt, Pixabay